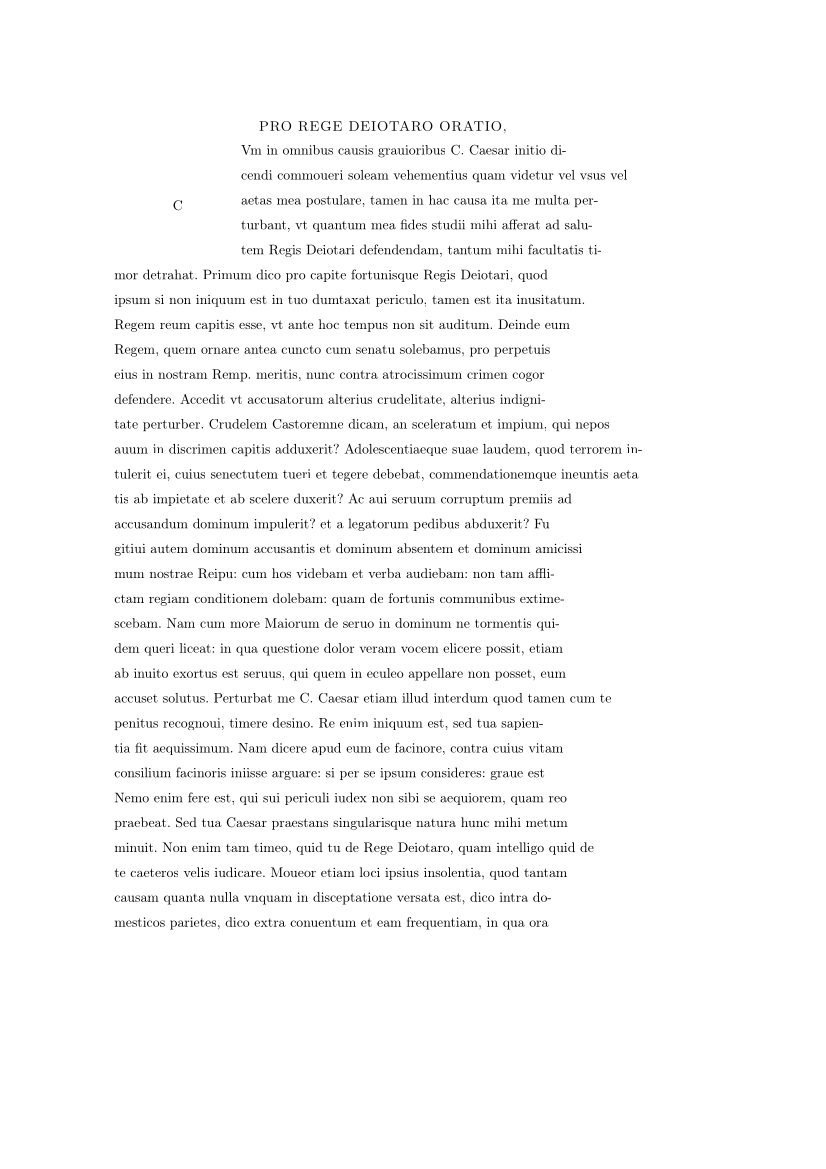A.2.4. Zur Durchführung
Da uns kaum direkte Mitschriften erhalten sind bzw. wir selbst dann, wenn wir eine Nachschrift für eine direkte Mitschrift halten, dennoch nicht beweisen können, dass es sich tatsächlich um eine solche handelt, haben wir zu wenige Anhaltspunkte, um Aubanus’ Vorgehen exakt zu rekonstruieren. Aber es scheint oft so, dass im oberen Bereich einer Seite Interlinearglossen, die in den Rand hineinragen, beim Schreiben der Marginalglossen berücksichtigt wurden, während weiter unten auf der gleichen Seite Marginalglossen beim Schreiben von längeren Interlinearglossen am Zeilenende im Weg waren. Dies konnte sich – so meine Vermutung – nur dann ergeben, wenn Aubanus abschnittsweise erst den Text näher erläuterte und dann die längeren Anmerkungen diktierte, die, wenn sie zahlreich und lang genug waren, neben noch unannotierten Text zu stehen kamen, was sich bis ans Ende der Seite fortsetzte. Dieses Vorgehen scheint auch pädagogisch sinnvoll, denn man muss den Text einmal kennengelernt und verstanden haben, um zu begreifen, worum es in den längeren Glossen überhaupt geht. Ich entschloss mich dazu, satzweise vorzugehen.
Ich bat zu Beginn des Experiments die Teilnehmer, möglichst alles mitzuschreiben, was ich diktierte, und während der Vorlesung keine Rückfragen zu stellen, da aus den Mitschriften eindeutig hervorgeht, dass damals auch niemand Rückfragen stellte. Sehr gern hätte ich beobachtet, wie viele Fehler die zu Aubanus’ Zeiten übliche Aussprache verursacht hätte, aber nach Absprache mit den Teilnehmern, die nicht daran gewöhnt waren, verzichtete ich darauf und bediente mich der klassischen Aussprache (ph sprach ich allerdings als f).
Ich merkte rasch, dass selbst ein recht langsames Vorlesetempo noch zu schnell war, als dass die Studenten ohne Mühe vollständig hätten mitschreiben können. Das war vor 500 Jahren vermutlich anders – zumindest ist schwer vorstellbar, dass Aubanus etwa eine Glosse wie die zu B1v 10, 1 defecerant Stück für Stück diktierte. Was die Synonyme und Satzergänzungen anbelangte, las ich jedoch in normalem Sprechtempo, da die vielen Wiederholungen den Studenten genug Zeit ließen, die Anmerkungen aufzuschreiben. Auch Stellenangaben las ich absichtlich immer schneller, um zu sehen, wie viele die Teilnehmer mitschreiben würden und ob sie spontan Abkürzungen gebrauchen würden.
Obgleich ich nicht viele Sätze außerhalb der Vorlesung sprach, musste ich irgendwann dazu übergehen, eine Aufforderung zu Mitschreiben der längeren Glossen zu geben, weil ich diese hinterher natürlich gerne vergleichen wollte. Wahrscheinlich war die Situation, eine lateinische Vorlesung zu hören, doch zu ungewohnt; jedenfalls nehme ich an, dass die Studenten in einer deutschen Vorlesung automatisch von sich aus mehr mitgeschrieben hätten.
Übrigens kam einer der Vorlesungsteilnehmer ein paar Minuten zu spät.
A.3. Auswertung der Mitschriften
Ich hatte zwar erwartet, dass sich ähnliche Situationen ergeben könnten wie in der Vorlesung bei Aubanus, aber dass tatsächlich allein bei der Behandlung eines vergleichsweise kurzen Stückes der Rede so vieles mit den Ergebnissen von damals übereinstimmen würde, hätte ich nicht gedacht.
Zunächst einmal merkt man den Mitschriften an, dass ihre Schreiber unterschiedliche Fertigkeiten mitbrachten: Während es dem einen anscheinend nicht schwerfiel, schnell mitzuschreiben, hat ein anderer – erkennbar am Schriftbild – Schwierigkeiten damit gehabt. Wieder ein anderer hat sich nicht bemüht, möglichst viel mitzuschreiben, sondern vielleicht nur, was ihm wichtig erschien; sein Exemplar ist sichtbar spärlicher annotiert als die anderen. Es mag eine Rolle gespielt haben, dass er nicht von Anfang an dabei war (er ist derjenige, der zu spät kam), und daher war er eventuell auch unsicher, wie er verfahren sollte. Wie aber zu erwarten war, weist seine Mitschrift natürlich eine Lücke auf: Über die Hälfte des Argumentums fehlt.
Von den in Kapitel 6 vorgestellten Phänomenen lassen sich einige an den Mitschriften beobachten. Häufiger als erwartet – immerhin war es eine kleine Gruppe und sehr leise im Raum – tauchen darin Hörfehler auf, und zwar oft die gleichen wie 1515. Wie damals hat auch in diesem Versuch jemand statt post pugnam Pharsalicam im Argumentum (Zusatztext 1) post pugna<m> versalicam geschrieben, sich also in gleicher Weise verhört und außerdem einen Flüchtigkeitsfehler gemacht, indem er das m in pugnam vergaß. Ein anderer hat pro Aulo Cluentio zu pro Aulo Cruentio verhört. Beim Diktieren dieser Glosse scheint noch mehr passiert zu sein, ohne dass ich mir beim Vorlesen eines Problems bewusst wurde: Statt magno cum metu steht in einer Mitschrift magno metuo, in einer anderen magno multo und in den übrigen ist dieser Teil ausgelassen. Offenbar hat keiner mitbekommen, wie es richtig hieß. Ob ich zu schnell war?
Der Fehler mit dem Namen Brogitarus (Marginalglosse 7) ist übrigens zwei Teilnehmern genauso unterlaufen wie den Studenten damals. Von den anderen beiden wusste einer wohl gar nicht, was er schreiben sollte; in seiner Mitschrift findet sich nur das Bruchstück rogita mit Auslassungspunkten am Ende. Der andere hat die Glosse überhaupt nicht mitgeschrieben. In derselben Glosse steht in einer Mitschrift iuves statt iubes als letztes Wort, was eindeutig wieder ein reiner Hörfehler ist, wie auch malletractabam statt maletractatam zu 19, 1 afflictam. ecquidem statt equidem (Marginalglosse 2) und condublicatio statt conduplicatio sind dagegen einfach Flüchtigkeitsfehler.
Im Angesicht all dieser diktatbedingten Fehler kommt die Frage auf, wie viele davon die Annotatoren des 16. Jahrhunderts bei der Anfertigung einer Reinschrift, als sie Zeit hatten, zu überdenken, was sie schrieben, getilgt haben mögen. Jedenfalls würde ich damit rechnen, dass die Studenten, die am Experiment teilnahmen, einige dieser Fehler zu beseitigen in der Lage wären.
Recht viel Kreativität bewiesen sie, was Verweissysteme betrifft. Zwei wiederholten jeweils zu Beginn der Marginalglossen die kommentierten Wörter aus dem Text. Einer davon setzte zusätzlich Unterstreichungen ein. Die beiden anderen haben Verweislinien benutzt, aber nur an wenigen Stellen. Es sind also in diesen vier Mitschriften fast alle in den Nachschriften aus dem 16. Jahrhundert dokumentierten Verweissysteme zum Einsatz gekommen. Dass selten Linien verwendet wurden, hat mich persönlich überrascht. In einer Situation, wo man wenig Zeit zum Überlegen und zum ordentlichen Schreiben hat, wäre das immer mein bevorzugtes System.
Die räumliche Aufteilung scheint den Studenten die größten Schwierigkeiten bereitet zu haben, womit sich erneut bestätigt, dass die meisten uns von damals erhaltenen Nachschriften eben keine direkten Mitschriften sind. Obwohl ich zu der Seite extra ein Deckblatt entworfen hatte, damit genug Platz für die Zusatztexte wäre, ahnte keiner, was auf ihn zukommen würde, und drei von vier Leuten fingen mit dem Argumentum tatsächlich auf der Textseite an. Erst als es zu lang wurde, wichen sie auf die Rückseite des Blattes aus. Nur einer schrieb auf das Deckblatt, und möglicherweise nur deshalb, weil er als derjenige, der zu spät kam, den Vorteil hatte, die anderen schon auf die freie Rückseite ihrer Textblätter schreiben zu sehen.
Da sie also fast alle durch die Blockierung des oberen Randes bereits mit Marginalglosse 1 auf einen Seitenrand auswichen, ergab es sich bei zweien, dass sie diese Glosse berücksichtigen mussten. Sie haben ein bis zwei Marginalglossen noch zwischen den Text und die blockierende Glosse gequetscht.
Korrekturen im Text und in Glossen sehen in den experimentellen Mitschriften genauso aus wie in den alten Nachschriften. Das h in 18, 5 hos haben alle durchgestrichen, manch einer dezent, manch anderer mit mehr Nachdruck. Die Korrektur der Stellenangabe im Argumentum (Zusatztext 1) von »13« nach »12« funktionierte ebenfalls wie erwartet.
Die bisherigen Beobachtungen beziehen sich alle auf Marginalglossen. Die Interlinearglossen sind weitgehend unauffällig, d. h. sie entsprechen natürlich auch dem Befund aus den alten Nachschriften. Oft haben die Studenten im Experiment nur ein Synonym aufgeschrieben, auch wenn ich mehrere nannte, nur hier und da finden sich zwei oder mehr. Natürlich haben manche auch Glossen ausgelassen, womit man rechnen konnte. Womit ich nicht gerechnet hatte, war das Vorhandensein von Sondergut. An einer Stelle in einer der Mitschriften ist jemand eigene Wege gegangen und hat zu 3, 1 aetas nicht iam senior notiert, wie ich diktiert habe, sondern senectus.
Eher zu erwarten war die Kürzung mancher Glossen. So haben etwa alle Studenten die Bemerkung zu den Redegattungen nur stichwortartig mitgeschrieben, wie es auch in manchen der alten Nachschriften steht: (tria) genera causarum: iudiciale, deliberativum, demonstrativum. Ebenso haben sie die Glosse zu 1, 1 Cum individuell gekürzt. Zwei schrieben nur quamvis, einer schrieb Quamvis (Valla) cf. elegantias und einer quamvis Laurentii Vallae vide elegantias.
An einer Mitschrift zeigte sich allerdings, dass ich doch noch nicht alles gesehen hatte. Ein Student schrieb nämlich die Interlinearglossen unter die Zeilen, nicht darüber. Lediglich ein paar Glossen zu Beginn des Textes stehen über den kommentierten Wörtern. Dieses Vorgehen ist vermutlich singulär. Zumindest wichen die Studenten des 16. Jahrhunderts nur in Fällen von Platzmangel unter die Zeile aus, und auch nur in der Mitte der Zeile, wenn der Rand schlecht erreichbar oder vielleicht sogar schon vollgeschrieben war. Selbst dann bemühten sich einige, die Zuordnung deutlich zu machen.
Das Experiment hat verdeutlicht, dass die Vorlesungsnachschriften aus dem 16. Jahrhundert wirklich Rückschlüsse auf den Ablauf des universitären Unterrichts vor 500 Jahren an der Universität Leipzig erlauben. All die Schwierigkeiten, mit denen die Vorlesungsbesucher damals konfrontiert wurden, lassen sich nicht nur aus einer Analyse der Nachschriften ableiten, sondern auch reproduzieren. Vermutlich lag ich auch mit meiner Art des Vortrags nicht allzu weit entfernt von dem, was Aubanus seinerzeit im Vorlesungssaal tat und sagte. Das war jedoch fast zu erwarten. Immerhin befand sich Laurentius Lyranus sicher in der gleichen Situation wie ich, d. h. er kannte nur Aubanus’ Aufzeichnungen aus zweiter Hand, und auch seine Hörer fertigten ja Nachschriften mit ganz ähnlichen Ergebnissen an wie die Annotatoren 1515.